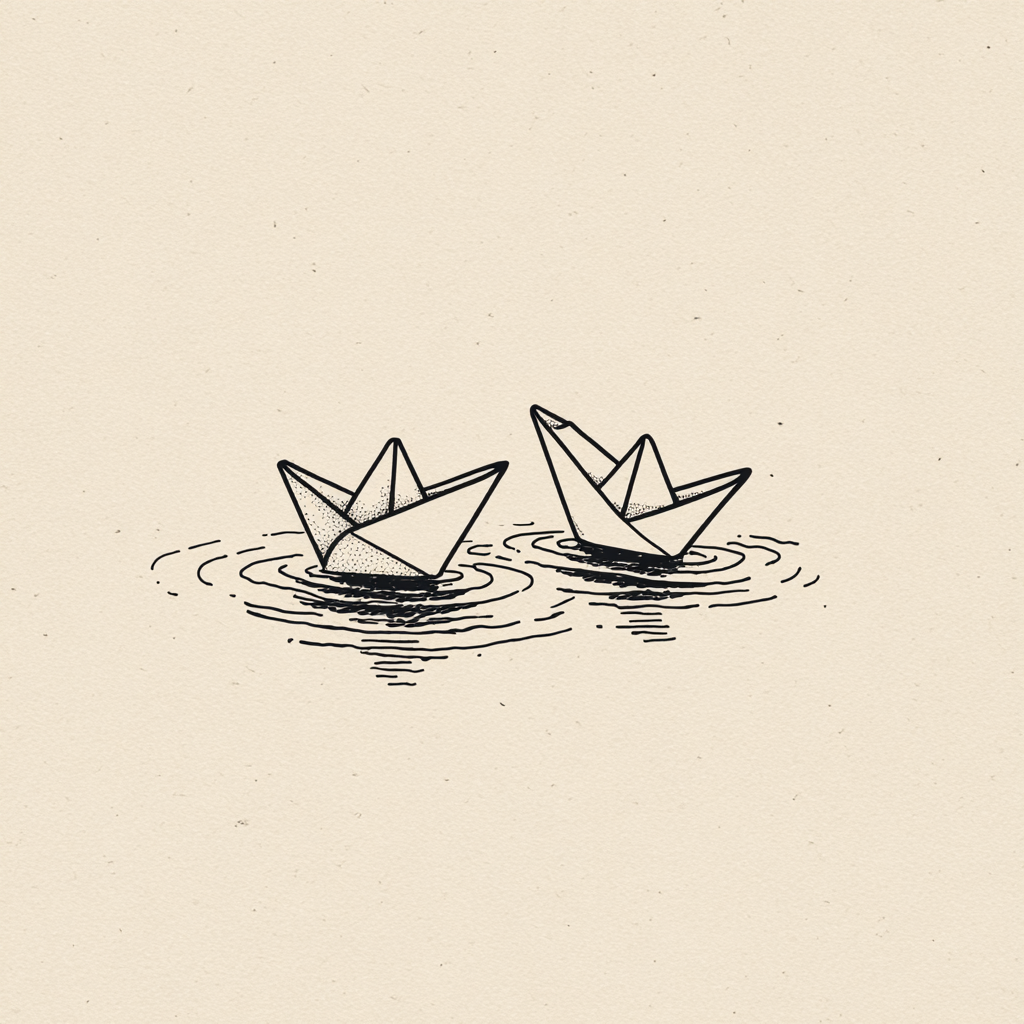Inhalt auf einen Blick
- – Was ist Mobbing – und was nicht?
- – Zwei Welten, zwei Regelwerke – Familie und Schule
- – Vormittag, Nachmittag – zwei Schulwelten unter einem Dach
- – Was wir konkret tun – Einblick in unseren Schulalltag
- – Was Eltern tun können – und was nicht hilft
- – Konflikte sind keine Betriebsunfälle – sie sind Lernfelder

„Mein Kind wird gemobbt.“
Dieser Satz fällt mittlerweile fast wöchentlich – in Elterngesprächen, in E-Mails, am Schultor in der Zeltgasse. Dahinter stehen echte Sorgen, manchmal auch Tränen. Kein Elternteil will, dass das eigene Kind leidet, ausgegrenzt wird, sich allein fühlt. Die Alarmglocken schrillen zu Recht, wenn ein Kind nach Hause kommt und erzählt, dass es nicht mitspielen durfte, dass jemand „gemein“ war, dass es sich in der Pause allein gefühlt hat.
Aber hier beginnt bereits das erste Missverständnis: Nicht jeder Konflikt ist Mobbing. Nicht jeder Streit eine Katastrophe. Und nicht jede Träne ein Hilferuf.
Das klingt hart – ist aber entwicklungspsychologisch eine Tatsache, die Eltern oft überrascht: Kinder brauchen Konflikte, um soziale Kompetenzen zu entwickeln. Sie müssen lernen, dass andere Menschen andere Bedürfnisse haben, dass nicht immer alle mit ihnen spielen wollen, dass Freundschaften sich verändern können. Diese Erkenntnisse sind schmerzhaft – aber sie sind notwendig. Und sie passieren nicht zuhause auf dem Sofa, sondern dort, wo Kinder aufeinandertreffen: in der Schule.
Die Frage ist also nicht, ob es Konflikte gibt. Die Frage ist: Wann wird aus einem normalen, wenn auch unangenehmen Entwicklungsschritt ein Problem, das Erwachsene lösen müssen? Und was bedeutet es eigentlich, wenn Kinder acht, neun oder zehn Stunden täglich in der Schule verbringen – nicht nur im Unterricht, sondern auch in der Freizeit?
Was ist Mobbing – und was nicht?
Orientierung im Schulalltag

Der norwegische Psychologe Dan Olweus, der als Begründer der Mobbing-Forschung gilt, hat eine klare Definition formuliert:
Forschung: Dan Olweus
„Mobbing liegt vor, wenn ein Kind wiederholt und über einen längeren Zeitraum negativen Handlungen ausgesetzt ist – und wenn dabei ein Machtungleichgewicht besteht.“
Drei Kriterien also: Wiederholung. Zeit. Macht.
Ein Kind, das einmal nicht mitspielen darf, wird nicht gemobbt. Zwei Kinder, die sich streiten, wer den Ball bekommt, sind in einem Konflikt – aber nicht in einer Mobbing-Situation. Ein Kind, das heute mit Anna spielt und morgen mit Ben, und Anna deswegen weint, durchlebt eine typische Freundschaftsdynamik der Volksschule – schmerzhaft, ja, aber entwicklungsbedingt normal.
Mobbing wäre: Ein Kind wird über Wochen systematisch ausgelacht. Sein Name wird zum Schimpfwort. Es traut sich nicht mehr in die Pause, weil es weiß, dass es wieder attackiert wird. Andere Kinder werden unter Druck gesetzt, es ebenfalls auszuschließen.
Den Unterschied zu kennen, ist nicht Haarspalterei. Er entscheidet darüber, wie wir reagieren. Wer jeden Konflikt als Mobbing behandelt, nimmt Kindern die Chance, soziale Kompetenz zu entwickeln. Wer echtes Mobbing übersieht, lässt ein Kind im Stich.
Zwei Welten, zwei Regelwerke – Familie und Schule
Zwischen Zuhause und Schule

Zuhause gelten andere Regeln als in der Schule. Das ist vielen Eltern theoretisch klar – aber emotional schwer zu akzeptieren.
Zuhause liebt man sein Kind bedingungslos. Man kennt seine Geschichte, seine Verletzlichkeit, seine Stärken. Man greift ein, wenn Geschwister streiten. Man tröstet, erklärt, schützt. Die Familie ist ein geschützter Raum, in dem Kinder sich sicher fühlen dürfen – und sollen.
Die Schule ist anders. Hier treffen 200 Kinder aufeinander, mit unterschiedlichen Temperamenten, Bedürfnissen, Vorerfahrungen. Hier gibt es keine bedingungslose Liebe, sondern Sympathie und Antipathie, wechselnde Konstellationen, Hierarchien, die ausgehandelt werden. Hier muss ein Kind lernen, dass es nicht immer im Mittelpunkt steht. Dass andere auch Aufmerksamkeit wollen. Dass Freundschaften nicht selbstverständlich sind, sondern gepflegt werden müssen.
Der Entwicklungspsychologe Robert Selman hat gezeigt, dass Kinder in Stufen lernen, die Perspektive anderer zu übernehmen. Ein Sechsjähriges kann noch nicht wirklich verstehen, wie sich das andere Kind fühlt – es ist kognitiv noch nicht so weit. Ein Achtjähriges beginnt zu begreifen, dass andere anders denken. Ein Zehnjähriges kann Kompromisse aushandeln. Diese Entwicklung braucht Übung. Und Übung bedeutet: Konflikte.
Beispiel aus dem Schulalltag
Zwei Kinder streiten sich um einen Ball. Kind A reißt ihn an sich, Kind B weint. Am Abend erzählt Kind B zuhause: „Niemand wollte mit mir spielen.“ Die Eltern sind entsetzt, schreiben eine Nachricht: „Unser Kind wird ausgegrenzt!“
Was ist passiert? Ein einmaliger Konflikt. Kein Machtungleichgewicht. Normale Dynamik. Kind B hat gelernt: Wenn ich den Ball will, muss ich vielleicht fragen, verhandeln, oder mir einen anderen Ball suchen. Unangenehm – aber eine zentrale soziale Lektion.
Wenn Eltern jetzt eingreifen, nehmen sie dem Kind diese Lernerfahrung. Sie signalisieren: Du kannst das nicht selbst lösen. Die Welt muss sich dir anpassen.
Das ist liebevoll gemeint – aber langfristig keine Hilfe.
Vormittag, Nachmittag – zwei Schulwelten unter einem Dach
Ganztägig lernen und leben

In einer Ganztagsschule wie der unseren verbringen Kinder nicht nur vier Stunden, sondern oft acht bis zehn Stunden täglich hier. Das verändert die Dynamik grundlegend – und viele Eltern sehen diesen Unterschied nicht.
Der Vormittag: Struktur, Leitung, Wissensvermittlung
Hier sind Lehrer:innen im Einsatz. Der Tag ist durchgetaktet: Deutsch, Mathematik, Sachunterricht, Technik und Design, Bewegung … Es gibt klare Ziele, Aufgaben, Erwartungen. Soziale Dynamiken sind präsent – natürlich streiten Kinder auch im Unterricht, bilden Grüppchen, testen Grenzen – aber der Raum dafür ist begrenzt. Lehrer:innen moderieren, setzen Rahmen, greifen ein, wenn nötig.
Der Nachmittag: Freiraum, Beziehung, Eigenverantwortung
Nach dem Mittagessen, nach der Lernstunde, beginnt die Freizeit. Jetzt sind Freizeitpädagog:innen da – und ihre Rolle ist eine andere. Sie sind nicht primär Wissensvermittler:innen, sondern Beziehungsgestalter:innen. Sie schaffen Räume, in denen Kinder spielen, sich bewegen, streiten, versöhnen, Freundschaften schließen – und manchmal auch zerbrechen lassen.
Peer-Sozialisation
Hier passiert das, was Entwicklungspsycholog:innen „Peer-Sozialisation“ nennen: Kinder lernen voneinander, nicht von Erwachsenen. Sie handeln aus, wer mit wem spielt, wer das Sagen hat, wer dazugehört. Sie erleben Zurückweisung und Zugehörigkeit. Sie üben, Konflikte zu lösen – oder sie eskalieren zu lassen.
Der Unterschied ist entscheidend:
Wenn Lehrer:innen bei jedem Streit sofort eingreifen würden, könnten Kinder nie lernen, selbst Lösungen zu finden. Wenn Freizeitpädagog:innen gar nicht hinsehen würden, könnten Konflikte in Mobbing kippen.
Die Kunst liegt im Beobachten, im Abwägen, im richtigen Timing. Manchmal heißt das: Aushalten, dass ein Kind weint, weil es gerade nicht mitspielen darf. Manchmal heißt es: Sofort eingreifen, weil ein Muster erkennbar wird.
Die Ganztagsschule bietet dabei einen Vorteil, den Halbtagsschulen nicht haben: Zeit.
Konflikte müssen nicht „abgewürgt“ werden, weil die Glocke läutet. Sie können bearbeitet, besprochen, aufgelöst werden. Kinder, die sich vormittags gestritten haben, können nachmittags wieder zusammenfinden – oder nicht. Sie erleben, dass Beziehungen dynamisch sind, dass Fehler passieren dürfen, dass Wiedergutmachung möglich ist.
Forschung: Ganztägigkeit und Kompetenzen
Forschung zu Ganztagsschulen (etwa die StEG-Studie aus Deutschland und Österreich) zeigt: Kinder, die ganztags in der Schule sind, entwickeln oft bessere soziale Kompetenzen – vorausgesetzt, die Qualität stimmt. Vorausgesetzt, es gibt nicht nur Beaufsichtigung, sondern echte Beziehungsarbeit.
Was wir konkret tun – Einblick in unseren Schulalltag
Arbeit an Beziehungen

„Was unternimmt die Schule eigentlich, wenn Kinder sich streiten?“ Diese Frage höre ich oft. Die Antwort ist: Vieles – aber nicht immer das, was Eltern erwarten.
Wir greifen nicht bei jedem Streit ein
Das wäre pädagogisch falsch. Kinder müssen die Chance haben, Konflikte selbst zu lösen. Ein Sechsjähriges, das lernt, „Stopp, ich will das nicht!“ zu sagen, hat mehr gewonnen als wenn die Lehrerin es „rettet“.
Wir beobachten
Pausen, Freizeiten, Mittagessen, Garderobenzeiten – überall dort, wo Kinder unter sich sind, sind Erwachsene in der Nähe. Nicht kontrollierend, sondern präsent. Das Konzept der „Neuen Autorität“ nach Haim Omer, das wir leben, setzt genau hier an: Präsenz statt Macht. Wir sind da, wir sehen, wir bleiben in Beziehung – auch wenn es schwierig wird.
Wir sprechen darüber
Im Klassenrat, in Klassengesprächen, nach Konflikten. Kinder lernen, Gefühle zu benennen, Perspektiven zu wechseln, Lösungen zu finden. Nicht durch Moralpredigten, sondern durch echte Auseinandersetzung.
Wir intervenieren, wenn Muster erkennbar werden
Ein einmaliger Streit ist normal. Wenn aber ein Kind über Wochen immer wieder ausgegrenzt wird, wenn es morgens Bauchschmerzen bekommt, wenn andere Kinder gezielt gegen es mobilisiert werden – dann handeln wir. Dann sprechen wir mit den beteiligten Kindern. Dann suchen wir das Gespräch mit den Eltern. Dann setzen wir Maßnahmen, die klar machen: Das geht nicht.
Wir arbeiten präventiv
Soziales Lernen ist kein „Extra“, sondern Teil des Lehrplans. Kinder lernen, was Empathie bedeutet, was Respekt heißt, wie Konflikte konstruktiv gelöst werden können. Nicht als Theorie, sondern im Alltag.
Was Eltern tun können – und was nicht hilft
Handwerkszeug für Eltern

Die gute Nachricht: Sie als Eltern können viel tun. Die weniger gute: Nicht das, was der Instinkt oft nahelegt.
Zuhören – ohne sofort zu handeln
Wenn Ihr Kind erzählt, dass es sich ausgeschlossen gefühlt hat, hören Sie zu. Nehmen Sie die Gefühle ernst. Aber springen Sie nicht sofort in den Rettungsmodus. Fragen Sie nach: „Was genau ist passiert? Wie oft war das schon so? Wer war dabei? Was hast du gemacht?“
Oft relativiert sich die Situation. Manchmal zeigt sich: Es war einmalig. Manchmal zeigt sich: Es gibt ein Muster.
Unterscheiden lernen
Ist es ein einmaliger Konflikt oder wiederholte Ausgrenzung? Gibt es ein Machtungleichgewicht (ältere Kinder gegen jüngere, Gruppe gegen Einzelnes) oder streiten Gleichaltrige? Wurde körperlich oder verbal angegriffen – oder war es „nur“ soziale Ausgrenzung (die trotzdem wehtut, aber anders zu behandeln ist)?
Dem Kind Handlungsfähigkeit zurückgeben
Statt zu sagen: „Ich rufe morgen in der Schule an und kläre das!“, fragen Sie: „Was könntest du selbst tun? Möchtest du mit der anderen Person reden? Soll ich dir helfen, die richtigen Worte zu finden?“
Kinder, die lernen, dass sie selbst etwas bewirken können, werden resilient. Kinder, die lernen, dass immer die Eltern eingreifen, bleiben abhängig.
Mit der Schule sprechen – aber wie?
Wenn Sie das Gefühl haben, dass etwas nicht stimmt, sprechen Sie mit uns. Aber nicht anklagend („Sie tun nichts!“), sondern kooperativ („Mir ist aufgefallen, dass … Können wir gemeinsam schauen?“).
Wir sind Partner, nicht Gegner. Wir wollen alle dasselbe: dass Ihr Kind sich wohlfühlt, lernt, wächst.
Resilienz stärken, nicht Konflikte vermeiden
Langfristig geht es nicht darum, Ihr Kind vor jedem Konflikt zu schützen. Es geht darum, es stark zu machen für die Konflikte, die kommen werden. Kinder, die lernen, mit Zurückweisung umzugehen, mit Frust, mit Enttäuschung, werden nicht brüchig. Sie wachsen.
Konflikte sind keine Betriebsunfälle – sie sind Lernfelder
Haltung unserer Schule

Eine Schule ohne Konflikte wäre keine gute Schule. Sie wäre ein steriler Raum, in dem Kinder nicht lernen, was es heißt, in einer Gemeinschaft zu leben.
Kinder, die nie erleben, dass nicht immer alle mit ihnen spielen wollen, sind später überfordert, wenn sie auf Ablehnung stoßen. Kinder, die nie lernen, sich zu entschuldigen, werden keine Beziehungen reparieren können. Kinder, die nie erfahren, dass Freundschaften auch Arbeit bedeuten, werden erwachsene Beziehungen nicht pflegen können.
Die Schule ist ein Übungsraum. Geschützter als die Welt da draußen, aber realer als die Familie. Hier dürfen Fehler passieren. Hier dürfen Kinder sich streiten, versöhnen, neu anfangen.
Unser Job ist es nicht, Konflikte zu verhindern. Unser Job ist es, sie zu begleiten – mit wachen Augen, mit klaren Grenzen, mit der Haltung, dass Kinder wachsen dürfen, auch wenn es wehtut.
Ihr Job als Eltern ist es, Ihrem Kind den Rücken zu stärken. Nicht indem Sie jeden Schmerz nehmen, sondern indem Sie zeigen: Ich vertraue dir. Ich bin da. Und ich glaube, dass du das schaffen kannst.
Wenn Sie das Gefühl haben, dass Ihr Kind in einer Situation feststeckt, die es allein nicht lösen kann, sprechen Sie uns an. Wir schauen gemeinsam hin – und handeln, wenn nötig.
Janusz Korczak
„Das Kind muss das Recht haben zu irren, nachzudenken, nicht zu wissen, zu glauben, nicht zu glauben, zu wissen – und nicht wissen zu müssen. Es hat das Recht, zu scheitern und trotzdem geachtet zu werden.“
„`